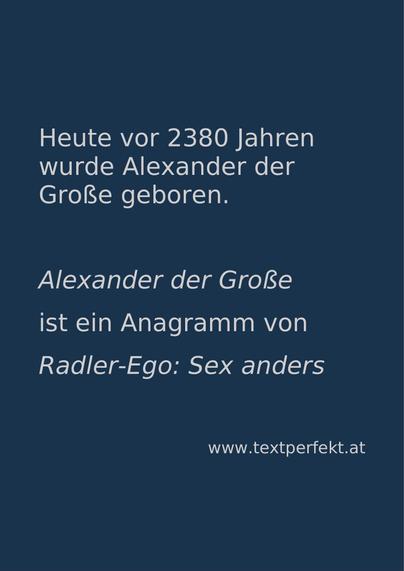#AlexanderderGro%C3%9Fe
Sternengeschichten: Hypatia von Alexandria
Völkerrechtliche Kritik an Alexander dem Großen und – später – an den Römern
Aus heutiger völkerrechtlicher Sicht, basierend auf Prinzipien des Humanismus, der Souveränität von Staaten und den Menschenrechten, gäbe es erhebliche Kritikpunkte an den Eroberungen und Regierungspraktiken Alexanders des Großen sowie der Römer. Diese historischen Akteure handelten in einer Zeit, in der es noch kein internationales Recht gab, wie wir es heute kennen. Dennoch lässt sich ihr Verhalten retrospektiv unter modernen Normen beleuchten.
1. Verstoß gegen das Verbot der Aggression
Sowohl Alexander als auch die Römer führten expansive Kriege, die im modernen Völkerrecht als Aggressionshandlungen gelten würden. Das moderne Völkerrecht, insbesondere die UN-Charta, verbietet die Anwendung von Gewalt zur territorialen Expansion. Alexander eroberte ein Reich von Griechenland bis Indien, wobei er zahlreiche Städte zerstörte und Bevölkerungen unterwarf. Ähnlich betrieben die Römer eine aggressive Expansion, die durch Kriege wie den Gallischen Krieg oder die Punischen Kriege geprägt war.
In beiden Fällen handelte es sich um Kriege, die primär der Machterweiterung dienten. Sie könnten nach heutiger Definition als völkerrechtswidrige Akte der Aggression betrachtet werden, da sie ohne legitimen Verteidigungsgrund erfolgten. Das römische Konzept des „bellum iustum“ (gerechter Krieg) diente oft als Rechtfertigung für Aggression, doch diese Rechtfertigungen entsprachen nicht den heutigen Anforderungen an die Selbstverteidigung.
2. Verstöße gegen die Menschenrechte und Kriegsverbrechen
Sowohl Alexander als auch die Römer sind für brutale Kriegsführung bekannt. Alexander zerstörte Städte wie Theben und Tyros, oft mit massiven zivilen Verlusten, um Widerstand zu brechen. Nach modernen Maßstäben wären dies schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, das zivile Opfer und unverhältnismäßige Gewaltanwendung verbietet.
Die Römer führten ebenfalls grausame Bestrafungen von unterworfenen Völkern durch, darunter Massenhinrichtungen, Versklavung und die Zerstörung ganzer Städte, wie es in Karthago der Fall war. Auch die Massaker, die Caesar während des Gallischen Krieges anrichten ließ, würden heute als Kriegsverbrechen gelten.
3. Verletzung der Souveränität und Selbstbestimmung
Ein weiterer Kritikpunkt wäre der systematische Bruch des Selbstbestimmungsrechts der unterworfenen Völker. Alexander setzte in vielen seiner eroberten Gebiete eigene Statthalter ein und versuchte, ein Herrschaftssystem zu etablieren, das die lokale Kultur weitgehend ignorierte. Dies wäre nach heutigen Standards eine Verletzung der Souveränität.
Die Römer etablierten in ihren eroberten Gebieten Kolonien und Provinzen, wobei sie oft die lokale Führungsschicht entmachteten und ein römisches Regierungssystem aufzwingen. Das moderne Völkerrecht schützt das Recht auf Selbstbestimmung, was impliziert, dass Völker das Recht haben, ihre politische, kulturelle und soziale Ordnung selbst zu bestimmen – ein Grundsatz, den weder Alexander noch die Römer beachteten.
4. Sklaverei und systematische Unterdrückung
Ein zentraler Kritikpunkt ist die extensive Nutzung der Sklaverei. Alexander nahm nach jeder Schlacht Sklaven und verkaufte sie, um seine militärischen Unternehmungen zu finanzieren. Auch die Römer machten weiten Gebrauch von Sklaven, um ihre Wirtschaft und militärischen Kampagnen zu stützen. In der heutigen Welt würde Sklaverei als schwerer Verstoß gegen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht angesehen werden. Die Römer schafften eine Gesellschaft, die auf der systematischen Unterdrückung ganzer Volksgruppen basierte, was heute als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewertet würde.
5. Zwangsassimilation und kulturelle Unterdrückung
Alexander propagierte eine Verschmelzung griechischer und orientalischer Kulturen, doch diese sogenannte „Hellenisierung“ wurde nicht immer freiwillig akzeptiert. In vielen Fällen war dies ein Versuch, durch kulturelle Dominanz seine Macht zu festigen. Auch die Römer förderten in ihren Kolonien und Provinzen die Romanisierung – oft zu Lasten der indigenen Kulturen. Solche Praktiken würden heute als kulturelle Unterdrückung oder sogar Völkermord betrachtet werden, wenn man etwa die Zerstörung oder Marginalisierung indigener Sprachen und Traditionen in Betracht zieht.
Was das bedeutet
Alexander der Große und das Römische Reich haben zweifellos bedeutende Beiträge zur Geschichte und Zivilisation geleistet. Dennoch würden ihre Handlungen aus heutiger völkerrechtlicher Perspektive in vielerlei Hinsicht verurteilt werden. Ihre expansive Kriegspolitik, die Verletzung der Souveränität, der massive Einsatz von Gewalt gegen Zivilisten, die systematische Versklavung und die kulturelle Unterdrückung verstoßen gegen die Grundprinzipien des modernen Völkerrechts.
Während historische Kontexte immer berücksichtigt werden müssen, zeigt dieser Rückblick auf, wie sehr sich das internationale Recht entwickelt hat, um die Menschenwürde, den Frieden und die Selbstbestimmung zu schützen.
https://god.fish/2024/09/26/voelkerrechtliche-kritik-an-alexander-und-den-roemern/
#AggressionsverbotAlexander #AlexanderDerGroße #KritikAntikeKriegsführung #MenschenrechteInDerAntike #Römer #RömerVölkerrecht #RömischeExpansionVölkerrecht #Völkerrechtsgeschichte #yellowCasa
Heute vor 2380 Jahren wurde Alexander der Große geboren.
Alexander der Große ist ein Anagramm von
Radler-Ego: Sex anders
#Geburtstagsanagramm
#AnagrammTextperfekt
#Anagramm #Anagramme #TeamAnagramm
#AlexanderDerGroße
Podcast "SPIEGEL Live" - Alexander der Große - DER SPIEGEL - Geschichte
#Geschichte #AlexanderderGroße #Podcast:SPIEGELLive #PodcastsvomSPIEGEL
#Podcast #TeilnehmerBitteSprechen #Kusanowsky #Inkommunikanbilität #Positivismus #AlexanderDerGroße #GoPodcasting
Gespräch über Inkommunikabilität anhand eines Beispieles mit Alexander dem Großen.
https://teilnehmer-bitte-sprechen.podigee.io/2-feststellungswissen