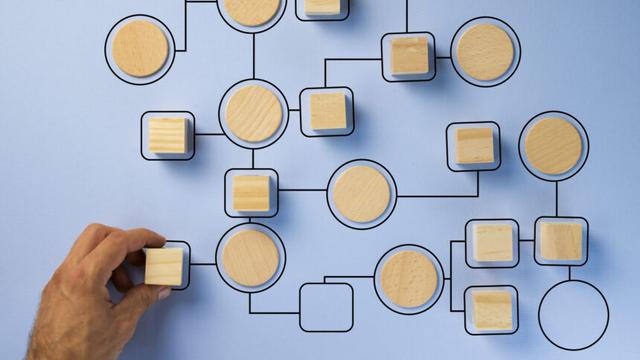Neuer Lokaljournalismus für Lindau: Kolumna setzt auf Qualität statt Klicks
Dieser Artikel stammt von CORRECTIV.Faktencheck / Zur Quelle wechseln
Neuer Lokaljournalismus für Lindau: Kolumna setzt auf Qualität statt Klicks
Seit 2024 gibt es mit Kolumna ein neues lokales Nachrichtenmagazin für die Region Lindau. Gegründet wurde es von Ronja Straub und Julia Baumann-Scheyer, zwei Journalistinnen mit langjähriger Erfahrung im Lokaljournalismus. Ziel des Projekts ist es, die Medienvielfalt in der Region zu stärken und eine fundierte Alternative zum zunehmend reichweitenorientierten Journalismus zu bieten. Zum Angebot von Kolumna gehören in erster Linie ein kostenloser täglicher Newsletter, vertiefende Beiträge für zahlende Abonnentinnen und Abonnenten auf der Website sowie ein Podcast.
von Svenja Schilling
17. Juni 2025
Ronja Straub auf der CORRECTIV.Lokal Konferenz I Foto: CORRECTIVDer Weg zur Gründung: Aus Kritik wurde ein Konzept
Die Idee zu Kolumna entstand aus der wachsenden Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen im klassischen Lokaljournalismus. Ronja Straub und Julia Baumann-Scheyer waren zuvor in der Lindauer Lokalredaktion der Schwäbischen Zeitung tätig. Dort rückten zunehmend Klickzahlen und digitale Reichweite in den redaktionellen Mittelpunkt – ein Trend, der aus ihrer Sicht im lokalen Kontext oft an den Bedürfnissen der Leserinnen und Lesern vorbeiging. Es fehlte an Raum für sorgfältige Recherchen, tiefere Einordnungen und echten Dialog mit der Community. Mit Kolumna wollten sie genau hier ansetzen: ein journalistisches Angebot schaffen, das die Region Lindau differenziert abbildet und den Anspruch verfolgt, mehrstimmig, transparent und nah an den Menschen vor Ort zu berichten.
Angebote und Formate
Das Hauptprodukt von Kolumna ist ein werktäglich erscheinender Newsletter. Er umfasst fünf Rubriken: Kurznachrichten, gute Nachrichten, eine Community-Umfrage, „Was wurde aus?“ sowie eine vertiefende Recherche. Der kostenlose Newsletter ist bewusst kompakt gehalten und enthält Verlinkungen zur Website, auf der ausführliche Beiträge zu finden sind – diese stehen allerdings ausschließlich zahlenden Abonnentinnen und Abonnenten zur Verfügung. Seit Anfang Februar 2025 betreibt Kolumna außerdem einen Podcast, der sich den Geschichten der Menschen aus der Region Lindau widmet. Perspektivisch sind zudem eine Schüler*innenredaktion und die Organisation verschiedener Veranstaltungen geplant.
So finanziert sich Kolumna
Das Geschäftsmodell von Kolumna basiert aktuell auf zwei Standbeinen: Einem Abo- sowie einem Anzeigen-Modell.
Das Abo-Modell umfasst verschiedene Abo-Stufen. Während der Crowdfunding-Kampagne konnte ein Abonnement für 7,50€ abgeschlossen werden. Aktuell sind das Basisabo für 12€ und das Förderabo für 25€ erhältlich. Zusätzlich gibt es ein Für-Alle-Abo, welches kostenlos ist und Personen mit geringem Einkommen beziehen können. Hierzu müssen sie lediglich eine E-Mail mit kurzer Begründung an das Koluma-Team schreiben. Trotz Abo-Modell ist es Kolumna wichtig, niemanden von ihrer Berichterstattung auszuschließen und einen breiten, demokratischen Diskurs zu fördern. Die Leistungen, die die Abonnentinnen und Abonnenten erhalten, sind bei allen Abo-Stufen identisch. Sie bekommen den Newsletter, Zugang zu allen Artikeln auf der Website, einen ausführlichen Veranstaltungskalender und können den Kolumna-Podcast hören.
Nach langen Überlegungen haben sich die Gründerinnen von Kolumna außerdem dazu entschieden, Anzeigen im Newsletter, auf der Homepage, im Podcast und bei Instagram zu schalten – aber alles sorgfältig ausgewählt und in abgeschwächter Form, so dass der Lesefluss nicht gestört wird. Zur Koordination der Anzeigen arbeitet ein Anzeigenleiter auf Provisionsbasis für Kolumna.
Zudem haben die Gründerinnen zu Beginn einen Gründungszuschuss vom Arbeitsamt erhalten, wodurch sie sich im ersten halben Jahr kein Gehalt auszahlen mussten. Obwohl sich Kolumna grundsätzlich durch das Abo- und Anzeigen-Modell finanzieren soll, strebt das Lokalmedium Förderungen an – unter anderem vom Media Forward Fund.
Das macht Kolumna zum community-basierten Medium
Community-Journalismus spielt schon seit Beginn eine große Rolle für Kolumna. Zur Vision gehört es, nicht nur Nachrichten für die Bürgerinnen und Bürger aus der Region Lindau zu erstellen, sondern auch ein Forum zu schaffen, in dem über aktuelle Themen diskutiert werden kann. Dieser Austausch soll sowohl im digitalen Raum als auch vor Ort bei Veranstaltungen stattfinden.
Um ein Produkt zu entwickeln, das den Bedürfnissen der Zielgruppe gerecht wird, hat Kolumna vor dem Start eine Umfrage mit Personen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten durchgeführt und so die Bedarfe abgefragt. Basierend auf dieser Umfrage hat Kolumna die Kernthemen der Befragten in den Newsletter einbezogen: einen Überblick über das Stadtgeschehen, konstruktive Nachrichten mit Lösungsvorschlägen sowie positive Berichterstattung.
Darüber hinaus bezieht Kolumna die Leserinnen und Leser regelmäßig über Community-Umfragen im Newsletter ein, bildet die Ergebnisse in der nächsten Ausgabe ab und recherchiert so gemeinsam mit der Community. Und, auch wenn es aktuell keine offenen Redaktionsräume gibt, suchen die Journalist*innen den Kontakt zu den Leuten, indem sie ihren Laptop immer mal an neuen Orten aufschlagen, wo sie mit Menschen ins Gespräch kommen können.
Die größten Herausforderungen
Die größte Herausforderung für Kolumna besteht zum einen darin, eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Der Newsletter wird derzeit vor allem von Personen abonniert, die sich bereits für Lokaljournalismus interessieren. Schwieriger ist es, darüber hinaus weitere Zielgruppen zu erschließen. Ein Ansatz, um diesem Problem zu begegnen, sind Pop-up-Redaktionen in Stadtteilen, in denen eher schwer erreichbare Menschen leben. Auf diese Weise möchte Kolumna auf seine Arbeit aufmerksam machen und mehr Menschen für Lokaljournalismus begeistern.
Zum anderen sollte Kolumna ursprünglich als gGmbH – also als gemeinnütziges Unternehmen – gegründet werden. Allerdings wurde der Antrag auf Gemeinnützigkeit vom Finanzamt abgelehnt, da nicht nachgewiesen werden konnte, dass mindestens 50 % der Aktivitäten von Kolumna gemeinnützig sind. Journalismus gilt nach aktueller Rechtslage nicht als gemeinnützig, weshalb rein journalistische Tätigkeiten nicht unter diese Kategorie fallen. Kolumna muss daher nun einen anderen Weg einschlagen. Die Erkenntnis: Wer als Medienunternehmerin oder -unternehmer ein gemeinnütziges Unternehmen gründen möchte, muss den gemeinnützigen Fokus klar in den Vordergrund stellen – sowohl in der Außenkommunikation als auch durch Aktivitäten wie Workshops, Veranstaltungen oder andere Non-Profit-Angebote.
Die Erfolgsfaktoren
Ein zentraler Erfolgsfaktor von Kolumna war der starke Start durch eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne, bei der bereits 700 Abonnentinnen und Abonnenten gewonnen werden konnten. So konnte Kolumna einen Proof-of-Concept vorweisen und belegen, dass ihr Produkt gefragt ist.
Zudem erwies sich die Wahl von Lindau als Standort als weiterer Erfolgsfaktor. Mit rund 26.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist die Stadt zwar klein, aber durch zahlreiche engagierte Multiplikator*innen sprach sich das neue Angebot schnell herum. Das zeigt, dass kleinere Städte trotz begrenzter Reichweite großes Potenzial für lokal verankerten Journalismus bieten können. Sicherlich hilfreich war auch, dass die Gründerinnen zuvor bereits als Lokaljournalistinnen in der Region gearbeitet hatten – ihre Namen waren bekannt und sie verfügten über ein gutes lokales Netzwerk.
Zur Quelle wechseln
Author: Svenja Schilling
#kolumna #lindau #lokaljournalismus #neuer #qualitat #setzt #statt