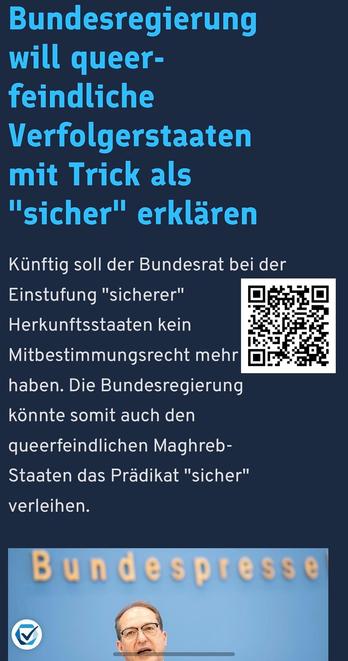Biometrie weltweit: Hier werden Protestierende mit Gesichtserkennung verfolgt
Dieser Artikel stammt von Netzpolitik.org.
Biometrie weltweit: Hier werden Protestierende mit Gesichtserkennung verfolgt
Viele Länder nutzen Gesichtserkennung, um Proteste und Demonstrationen zu überwachen und zu unterdrücken. Ein Überblick über Biometrie-Hotspots zeigt, wie ernstzunehmend die Auswirkungen auf die Demokratie sind.
20.04.2025 um 08:50 Uhr
–
Martin Schwarzbeck – in
Überwachung –
10 Ergänzungen Die rot markierten Nationen verwenden automatisierte Gesichtserkennung.
– Gemeinfrei-ähnlich freigegeben durch unsplash.com Karte Datawrapper, Kameras unsplash.com/@lianhao, Gesicht unsplash.com/@ludvigwiese Indien nutzt Drohnen, um Teilnehmer*innen von Bauernprotesten zu identifizieren – und ihnen anschließend die Pässe zu entziehen. Im Iran bekommen Frauen, die von Kameras ohne Kopftuch gefilmt werden, automatisch eine SMS, die ihnen erklärt, dass sie jetzt ein Problem haben. Und in den USA jagt eine private Gruppierung mit Gesichtserkennung propalästinensische Demonstrierende, um sie ausweisen zu lassen.
Das ist nur eine kleine Auswahl der vielen Länder, in denen Gesichtserkennung gegen Protestierende eingesetzt wird. In mindestens 78 Ländern nutzen Behörden die Technologie, so eine Studie. Da die Erhebung von 2022 stammt, sind inzwischen vermutlich noch mehr Staaten beteiligt. Ob sie mit der Technologie auch Demonstrierende identifizieren, ist nicht immer eindeutig zu klären.
„Es ist ein massives Problem und es nimmt massiv zu“, sagt Christoffer Horlitz, Experte für Menschenrechte im digitalen Zeitalter bei Amnesty International Deutschland. Und er sieht keinen Grund zur Annahme, dass dieser Trend abnimmt.
Einst schützte die Masse Teilnehmer*innen von Straßenprotesten. Nun, wo einzelne Teilnehmende aus der Ferne einfach identifiziert und dann später zu Hause abgeholt werden können, gibt es diesen Schutz nicht mehr. Wer an einer Demo teilnimmt, muss damit rechnen, auf einer Feindesliste der Regierung oder des politischen Gegners zu landen. Allein, weil man sein Gesicht, dieses unverwechselbare Kennzeichen, stets mit auf die Demo trägt.
„Die Angst, verfolgt zu werden, wächst. Und die dystopischen Szenarien dazu müssen wir uns gar nicht ausdenken, die sehen wir ja zum Beispiel in Russland“, sagt Horlitz. Dort würden kaum noch Proteste stattfinden, weil die potenziellen Teilnehmer*innen Angst vor Konsequenzen hätten.
Horlitz sagt, es sei wichtig, dass Menschen anonym politische Proteste besuchen können. „Die Versammlungsfreiheit ist ein Grundrecht und das ist sonst in Gefahr.“ Amnesty International positioniert sich dementsprechend zum Beispiel auch gegen das in Deutschland geltende Vermummungsverbot auf Versammlungen. Weil die Versammlungsfreiheit, auch durch die neuen Technologien, gerade besonders gefährdet sei, hat Amnesty International die Kampagne “Protect the Protest” initiiert.
Aus einer ganzen Reihe von Ländern gibt es Berichte über den Einsatz von automatisierter Gesichtserkennung gegen Protestierende. Die Beispiele zeigen, wie gefährlich diese Nutzung für die demokratischen Grundrechte ist.
Deutschland
Deutsche Behörden sollen künftig die Bilder von Überwachungskameras automatisch mit Fotos aus dem Netz abgleichen können.
– Alle Rechte vorbehalten IMAGO / Frank SorgeAuch in Deutschland wird automatisierte Gesichtserkennung zur Identifizierung von Demonstrierenden genutzt. Besteht die Gefahr, dass Straftaten begangen werden, darf die Polizei auf Demonstrationen filmen. Werden tatsächlich Straftaten aufgezeichnet, ist es legal, die Bilder durch das Gesichtserkennungssystem (GES) des Bundeskriminalamtes laufen zu lassen. Bei den Protesten gegen das Treffen der G-20-Staatschefs in Hamburg wurden so drei Tatverdächtige identifiziert.
Das GES vergleicht die Bilder der zu identifizierenden Personen mit einer Datenbank aus rund 7,6 Millionen Porträtfotos, die vor allem im Rahmen von erkennungsdienstlichen Behandlungen oder Asylverfahren erstellt wurden. Dazu kommt eine amtsinterne Datei mit deliktspezifischen Fotos. Nach dem erweiterten Prüm-Beschluss dürften auch andere europäische Datenbanken genutzt werden. Spuckt das GES einen Treffer aus, muss der von einem Menschen verifiziert werden. Rund 141.000 Recherchen wurden 2024 im GES durchgeführt, etwa 20 Prozent mehr als im Vorjahr.
Geht es nach der künftigen Bundesregierung, wird die zum Abgleich genutzte Bilddatenbank deutlich größer werden. Laut dem Koalitionsvertrag soll nämlich auch ein Abgleich mit öffentlich einsehbaren Bildern aus dem Internet möglich sein. „Das würde natürlich auch bedeuten, dass damit Bilder aufgestöbert werden können, die Menschen auf einer Demonstration zeigen“, sagt Christoffer Horlitz von Amnesty International.
Österreich
Laut Standard kam 2020 in Österreich automatisierte Gesichtserkennung zum Einsatz, um antifaschistische Aktivist*innen zu identifizieren. Genutzt wurde Technik von Cognitec Systems. 450.000 Euro habe die Software gekostet. Der Einsatz sei laut Innenministerium durch das Sicherheitspolizeigesetz gedeckt.
Nach der KI-Verordnung der EU dürfen Straftäter*innen nachträglich mit automatisierter Gesichtserkennung identifiziert werden. Sogar der Einsatz von Live-Gesichtserkennung ist möglich, wenn es beispielsweise um die Suche nach einer vermissten Person geht oder die Gefahr eines Terroranschlages besteht.
Ungarn
In Ungarn ist der Einsatz von Gesichtserkennung gegen Demonstrierende gerade besonders aktuell. Das Land hat kürzlich die Teilnahme an Pride-Demonstrationen, die die Vielfalt der Geschlechter und der sexuellen Orientierungen feiern, verboten. Es wurde angekündigt, dass die Polizei auch Gesichtserkennung einsetzen wird, um die Teilnehmer*innen solcher Demonstrationen zu identifizieren und mit Geldstrafen zu belegen. Der Demobesuch gilt als Ordnungswidrigkeit, das Gesetz, das den diesbezüglichen Gesichtserkennungssoftwareeinsatz legitimiert, erlaubt also theoretisch sogar, automatisierte Gesichtserkennung gegen Falschparker einzusetzen.
Die Bilder, auf denen Menschen identifiziert werden sollen, werden dabei mit einer Datenbank abgeglichen. Diese beinhaltet biometrische Profile von Bildern aus erkennungsdienstlichen Behandlungen und aus den Akten Geflüchteter, daneben aber auch die Gesichtsdaten von Fotos aus Pässen und Führerscheinen. Letzteres ist weltweit noch relativ selten. Viele Staaten scheuen sich davor, die automatisierte Gesichtserkennung direkt an die Passdatenbank anzuschließen, weil damit jede*r Bürger*in unter Verdacht gestellt wird.
Anfangs mussten die Matches, die das ungarische Gesichtserkennungssystem auswarf, noch in jedem Fall von zwei menschlichen Expert*innen unabhängig voneinander bestätigt werden. Nach einer Änderung im vergangenen Jahr ist bei der Verfolgung minderschwerer Fälle – wie wohl dem Besuch einer Pride-Parade – keine derartige menschliche Autorisierung mehr notwendig. Das System entscheidet selbstständig, wer die Person auf dem Foto ist. So soll der Identifikations-Prozess beschleunigt werden. Aber gerade bei Massenaufläufen steigt damit die Fehlerwahrscheinlichkeit enorm, schreibt das ungarische Onlineportal 24.hu.
Serbien
In Belgrad hängen tausende smarte Kameras.
– Alle Rechte vorbehalten IMAGO / Pond5 ImagesIn Serbien, wo kürzlich pro-demokratische Demonstrierende mit einer bislang unbekannten Waffe angegriffen wurden, ist auch die Kameraüberwachung auf den neuesten Stand. 2019 kündigte die Regierung an, tausende smarte Kameras des chinesischen Konzerns Huawei in der Innenstadt der Hauptstadt Belgrad zu installieren. 2021 wurden dann Berichte bekannt, nach denen Gesichtserkennungstechnologie gegen politische Gegner eingesetzt wurde. Viele Protestierende, vor allem Teilnehmer*innen von Straßenblockaden, hatten Strafen erhalten, obwohl sie sich nicht gegenüber Polizeikräften ausgewiesen hatten.
Ein Bericht der NGO Balkan Investigative Reporting Network zeigt, dass die serbische Polizei auch chinesische Drohnen eingekauft hat, um Demonstrationen und Grenzen zu überwachen. Die Drohnen seien mit hochwertigen Kameras ausgestattet und könnten sich sogar bestimmte Gesichter merken, um diese zu verfolgen. Laut des Berichts von 2024 sind in Serbien mittlerweile 8.000 Kameras installiert, die zur Gesichtserkennung genutzt werden können.
„Das System kann genutzt werden, um politische Gegner zu verfolgen und Regimekritiker zu jedem Zeitpunkt zu überwachen, was komplett gegen das Gesetz ist“, sagte Serbiens vormaliger Datenschutzbeauftragter Rodoljub Sabic laut CBS News. In dem Bericht von 2019 wird behauptet, dass die Polizei Protestvideos an regierungsfreundliche Medien durchsteche, die dann Bilder daraus mit den Namen der Protestierenden veröffentlichten. Der Präsident Aleksandar Vučić habe behauptet, er könne jede*n Beteiligte*n von Anti-Regierungsprotesten registrieren.
Laut der Heinrich-Böll-Stiftung ist Belgrad die erste europäische Hauptstadt, die nahezu flächendeckend von Kameras überwacht wird, die für den Einsatz mit automatisierter Gesichtserkennung geeignet sind. Sowohl in Belgrad, als auch in den Großstädten Niš und Novi Sad würde hauptsächlich Safe-Cities-Technologie von Huawei eingesetzt. Die Polizei nutze neben stationären Kameras auch Bodycams und in Fahrzeugen verbaute Videoüberwachung.
Allerdings gäbe es laut des serbischen Datenschutzbeauftragten keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung biometrischer Daten. Eine Datenschutz-Folgenabschätzung von 2020 habe allerdings ergeben, dass bereits damals alle Personen, die gewisse Kameras passieren, biometrisch identifiziert wurden und die Polizei die Informationen nutzte, um Persönlichkeitsprofile aufzubauen. Laut der SHARE Foundation, einer Datenschutzorganisation aus Belgrad, hat die Polizei den Plan zugegeben, die Personalausweisdatenbank zu Identifizierungszwecken zu nutzen, berichtet ZDnet.
Großbritannien
Großbritannien hat ein extrem dicht ausgebautes Netz an Überwachungskameras für den öffentlichen Raum, zudem ist das Land auch beim Einsatz von Gesichtserkennung gegen große Menschenmengen ganz vorn dabei. Das geschah beispielsweise bei der Krönung von König Charles III im Mai 2023 und ebenfalls 2023 im Rahmen eines Formel-1-Rennens. Dabei wurde versucht, Klimaaktivist*innen vom Betreten der Rennstrecke abzuhalten.
In der Videoüberwachung des öffentlichen Raums von Großbritannien läuft eine Echtzeit-Gesichtserkennung permanent mit. Seit Ende März 2025 sind Menschen, die dort demonstrieren wollen, der Technologie noch hilfloser ausgeliefert. Da trat ein Gesetz in Kraft, das die Verhüllung des Gesichts auf Versammlungen zur Straftat macht. Es drohen 1.000 Pfund Strafe und ein Monat Gefängnis.
Türkei
Auch in der Türkei, wo zur Zeit größere Proteste stattfinden, spielt die Identifizierung von Demonstrierenden mittels automatisierter Gesichtserkennung für die Sicherheitsbehörden wohl eine wichtige Rolle. „Wenn du heute in der Türkei an einer Demonstration teilnimmst, wird dein Gesicht von einer Kamera erkannt und das System gleicht es mit deinem Profil in den sozialen Netzwerken ab.“ sagte Orhan Sener, ein Experte für digitale Technologien, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Dem Bericht zufolge holte die Polizei viele Demonstrant*innen zu Hause ab, nachdem sie anhand von Filmmaterial oder Fotos identifiziert worden waren.
Georgien
In Georgien werden Menschen, die Straßen blockieren, auf Basis von Kamerabildern verurteilt.
– Alle Rechte vorbehalten IMAGO / Frank SorgeOffiziell sind in Georgien nur der Flughafen und die Grenzkontrollpunkte mit Gesichtserkennungssystemen ausgestattet. Genutzt wird Technik des japanischen Konzerns NEC. 2023 wurde die Technologie mit Hilfe eines EU-Programms finanziert, berichtet biometricupdate.com.
Trotz der Restriktionen seien in den letzten Jahren 4.300 smarte Kameras im öffentlichen Raum installiert worden, hauptsächlich von den chinesischen Firmen Hikvision und Dahua, schrieb biometricupdate.com im Februar 2025. Berichten zufolge habe das Innenministerium zudem Gesichtserkennungstechnologie von Papillon Systems eingesetzt. Unbekannt sei, wer die Kameras kontrolliere und welche Funktionen sie böten.
In Georgien gibt es seit einiger Zeit große prodemokratische Proteste. Die Georgian Young Lawyers’ Association berichtete der NGO Civil Georgia im März von zahlreichen Fällen, in denen Menschen, die an Straßenblockaden teilnahmen, nur auf Basis von Kamerabildern identifiziert und verurteilt wurden. Dabei gehe es auch darum, Protestierende einzuschüchtern.
In einem anderen Fall sei ein Mensch mittels Überwachungskameras quer durch die Stadt verfolgt worden. Als die Person ein Dokument las, sei so nah herangezoomt worden, dass auch die Überwachenden mitlesen konnten. Laut Civil Georgia ist die Zahl der Kameras exponentiell gewachsen, vor allem in Gegenden, in denen häufig demonstriert werde.
Russland
Christoffer Horlitz von Amnesty International sagt: „In Russland beobachten wir schon seit Jahren, dass Gesichtserkennungstechnologien auf Protesten eingesetzt werden. Und das hat gruselige Ausmaße.“ Früher konnte man nach einer Demonstration, wenn man wieder zu Hause war, davon ausgehen, dass man diesmal unbeschadet davongekommen ist. Im heutigen Russland ist es möglich, dass noch Wochen nach einer Demonstration die Sicherheitsbehörden Beteiligte zu Hause oder am Arbeitsplatz aufsuchen und festnehmen.
Als Beispiel nennt er die Proteste nach der Beerdigung des Oppositionellen Alexej Nawalny im März 2024. Die NGO OVD-Info bestätigt die Praxis und hat seit 2021 knapp 600 Fälle gesammelt, in denen Demonstrationsteilnehmer*innen mittels Gesichtserkennung ins Visier der Behörden gerieten.
In Moskau und anderen russischen Städten werden U-Bahnen mit Gesichtserkennung überwacht, man kann sogar mittels Gesichtserkennung bezahlen. Es sei schon mehr fach vorgekommen, dass Menschen, die auf einer Demonstration von Gesichtserkennungstechnologie erfasst wurden, am U-Bahneingang identifiziert und festgenommen wurden, sagt Horlitz. Das hieße, dass die russischen Sicherheitsbehörden Zugriff auf eine Vielzahl von Kameras haben.
Horlitz berichtet auch von präventiven Festnahmen, bei denen Menschen, die als Demonstrationsteilnehmer*innen identifiziert wurden, vor erneuten Protesten von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. 141 präventive Festnahmen von Aktivist*innen allein in der U-Bahn hat OVD-Info gezählt.
2021 sind sogar drei Journalisten verhaftet wurden, nachdem sie von Gesichtserkennungssoftware bei einem Protest identifiziert wurden. Horlitz sagt: „Am Beispiel Russlands sehen wir einen deutlichen Abschreckungseffekt. Es werden mittlerweile weniger Menschen aus politischen Gründen verhaftet, weil es gerade auch einfach viel weniger Proteste gibt.“
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschied 2023, dass die russische Praxis, Regimegegner mittels Gesichtserkennung zu verfolgen, die Meinungsfreiheit und die Privatsphäre verletzt. Auslöser war die Festnahme eines Soloprotestierenden mit kritischem Schild, der mittels Gesichtserkennung in der U-Bahn identifiziert und anschließend verhaftet wurde.
Auch in Russland setzten in der Vergangenheit bereits private Akteure Gesichtserkennung gegen Protestierende ein. Mit der App findface.ru wurden bereits 2017 Regierungsgegner mit Foto, Namen und Link zu ihren Auftritten in Sozialen Netzwerken auf einer Website geoutet. Ein Geheimdienstnahes Internetportal hatte hochauflösende Panoramabilder von Demonstrationen zur Verfügung gestellt.
Palästina
Laut Christoffer Horlitz von Amnesty International ist Videoüberwachung in den israelisch kontrollierten Gebieten von Hebron und Ost-Jerusalem allgegenwärtig. „Das heißt, wenn ich auf einem Protest bin, der unliebsam ist und dann das nächste Mal durch einen Checkpoint gehen will, werde ich nicht durchgelassen“, sagt Horlitz.
An den Checkpoints arbeitet ein Gesichtserkennungssystem namens Red Wolf, das automatisch entscheidet, wer passieren darf, wer weitere Kontrollen über sich ergehen lassen muss und wer direkt festgenommen wird. Zusätzlich gibt es die Handy-App Blue Wolf, mit der Soldaten die Gesichter von Palästinenser*innen erfassen können.
Iran
In Iran werden Überwachungsaufnahmen mit Personalausweisfotos abgeglichen.
– Alle Rechte vorbehalten IMAGO / ZUMA Press WireIm autoritären Iran gilt es schon als Protest, wenn eine Frau ihr Kopftuch nicht ganz wie vorgeschrieben trägt. Gegen diese Form der Rebellion fährt das Regime auch einen exzessiven Einsatz von automatisierter Gesichtserkennung auf.
Rest of World berichtet von Maryam, 30, die 2023 ohne Hidschab in einem Café saß. Nachdem die 22-jährige Mahsa Amini in Polizeigewahrsam gestorben war, weil sie das Kopftuch nicht korrekt trug, habe Maryam aus Protest gelegentlich ihren Kopf unbedeckt gelassen. Einige Monate nach dem Cafébesuch sei Maryam von einem Gericht vorgeladen worden, als Beweismittel gab es ein Foto des Cafébesuchs.
Maryam gehe davon aus, per Gesichtserkennung identifiziert worden zu sein, berichtet Rest of World. „Es gab keine andere Möglichkeit, mich zu erkennen“, wird Maryam zitiert. Das Regime habe zuvor bereits angekündigt, mit Gesichtserkennung gegen Kopftuchtragevergehen vorzugehen.
Der Sekretär der iranischen Zentrale für Tugendförderung und Lasterprävention habe erklärt, die Bilder würden mit der nationalen Datenbank für Personalausweise abgeglichen. Christoffer Horlitz von Amnesty International bestätigt, dass im Iran die Passfotos der Bürger*innen zum Abgleich mittels Gesichtserkennungstechnologie genutzt werden.
Laut Rest of World arbeiten zwei iranische Unternehmen bereits seit 2015 gemeinsam mit den Behörden an Gesichtserkennungstechnologie. Außerdem habe Iran Smartkameras von der chinesischen Firma Tiandy Technologies erworben. Angeblich wird auch mit Kameradrohnen Jagd auf Kopftuchverweigerinnen gemacht. Laut Christoffer Horlitz erhalten Frauen, die mittels Gesichtserkennungstechnologie ohne Kopftuch erwischt werden, automatisch eine SMS mit dem Hinweis, dass sie gegen die Vorschriften verstoßen hätten und einer Strafandrohung.
Auch im Iran wird Gesichtserkennung regelmäßig in öffentlichen Verkehrsmitteln genutzt. Es gibt Berichte von U-Bahn-Nutzer*innen, die Überwachungskameras passierten, woraufhin ihre Passfotos mit ihrem Namen auf einem Bildschirm erschienen. Ein Sprecher des entsprechenden Stadtrats habe anschließend erklärt, die Technologie werde ausschließlich zur Festnahme von „Regimefeinden“ eingesetzt, so Rest of World.
USA
In den USA ist automatisierte Gesichtserkennung bereits so selbstverständlich, dass sie in einigen Sportstadien zur Einlasskontrolle genutzt wird. Die Hälfte der US-Bürger*innen war bereits 2016 mit Foto in einer Gesichtserkennungs-Datenbank erfasst. Und sowohl staatliche Institutionen als auch Privatpersonen gehen mit der Technologie gegen Demonstrierende vor.
Die Strafverfolgungsbehörden setzten beispielsweise 2020 im Rahmen der Black-Lives-Matter-Proteste Gesichtserkennung ein. Mindestens ein Aktivist sollte in Folge dessen in seinem Zuhause von Staatsvertretern verhaftet werden, berichtet das gemeinnützige Online-Medium Rest of World. Christoffer Horlitz von Amnesty International sagt: „teilweise wurden die Demorouten so an den Überwachungskameras entlang gelegt, dass die gesamte Route überwacht wurde.“
Angeblich haben gleich sechs verschiedene Behörden Gesichtserkennung gegen die Black-Lives-Matter-Aktivist*innen eingesetzt, so das kanadische Medium Ricochet. Die eingesetzte KI ist Clearview AI, schreibt das politische Magazin Mother Jones. Die sei explizit dazu entwickelt worden, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit einer linken politischen Einstellung zu identifizieren und verfolgen. Allerdings hat das Unternehmen wohl auch 2021 bei der Aufklärung des Sturms auf das US-Kapitol eine größere Rolle gespielt. Auf seiner Website veröffentlichte es eine Fallstudie, die seine Rolle bei der Festnahme hunderter Randalierer hervorhob.
Zuletzt wurde zudem bekannt, dass in den USA auch Privatpersonen Gesichtserkennung gegen Demonstrierende einsetzen. Der Software-Entwickler Eliyahu Hawila hat eine Gesichtserkennungstechnologie namens Nesher AI entwickelt, die explizit dazu gedacht ist, propalästinensiche Demonstrierende zu identifizieren. Die Daten dieser Menschen werden mit der US-Regierung geteilt, in der Hoffnung, dass die Protestierenden daraufhin abgeschoben werden. Auch maskierte Menschen kann das Tool wohl erkennen.
China
Automatisierte Gesichtserkennung wird in China zur Kontrolle der Bevölkerung genutzt.
– Alle Rechte vorbehalten IMAGO / Matrix ImagesDieses Land spielt eine Vorreiterrolle beim Einsatz von automatisierter Gesichtserkennung. Die Technologie wird umfassend eingesetzt und ist hoch entwickelt. So kann sie beispielsweise automatisch Alarm schlagen, sobald Menschen zu einer ungenehmigten Versammlung zusammenkommen. Sie kann auch Uiguren von Han-Chinesen unterscheiden. Die uigurische Minderheit wird besonders stark mittels Kameraüberwachung kontrolliert.
In Chinas öffentlichem Raum sind Millionen von Überwachungskameras verteilt. Die werden auch eingesetzt, um Protestierende zu identifizieren, die dann mit einer Art Gefährderansprache von weiteren Protesten abgehalten werden sollen. Zwei Firmen, die weltweit führende KI-Kamerasysteme entwickeln, Hikvision und Huawei, stammen aus China. Hikvision ist ein Staatsunternehmen, Huawei wird vom Staat gefördert.
Die „Safe-Cities“-Technologie von Huawei wurde laut CBS News bereits 2019 nach Russland, Ukraine, Türkei, Aserbaidschan, Angola, Laos, Kasachstan, Kenia, Uganda, Frankreich, Italien und Deutschland vertrieben.
Indien
In Indien wurde 2024 Gesichtserkennung gegen Teilnehmer*innen von Bauernprotesten eingesetzt. Ein leitender Polizist sagte: „Wir haben sie mithilfe von Überwachungskameras und Drohnen identifiziert. Wir werden das Ministerium und die Botschaft bitten, ihre Visa und Pässe zu annullieren.“
Bereits 2019 wurden vor und nach Protesten, die sich gegen ein Gesetz richteten, das Muslime diskriminiert, Teilnehmer*innen von der Polizei festgesetzt. Angesichts der Menge der betroffenen Menschen und der im Einsatz befindlichen Überwachungskameras, vermuteten Aktivist*innen, dass Gesichtserkennung im Einsatz sei.
2020 gab es ebenfalls Proteste gegen das Gesetz und Unruhen im Nordosten Delhis. Laut dem dortigen Polizeipräsidenten wurden danach 775 Menschen festgenommen, von denen 231 mit Videoüberwachung identifiziert worden seien und 137 davon mit automatisierter Gesichtserkennung, so berichtet Rest of World. Laut Christoffer Horlitz von Amnesty International wurden in Indien auch Studierende, die zum ersten Mal auf einer Demo waren, dort per Gesichtserkennung identifiziert und nach der Veranstaltung an der Universität verhaftet.
Der indische IT-Forscher Srinivas Kodali sagte gegenüber Rest of World, dass Proteste in seiner Region sehr selten geworden seien, seit die Polizei Gesichtserkennung einsetzt. „Die Polizei verhaftet Menschen, bevor sie überhaupt zum Protestort kommen“. Die indische Internet Freedom Foundation überwacht den Ausbau der automatisierten Gesichtserkennung mit einem Projekt namens Panoptic.
Zur Quelle wechseln
Zur CC-Lizenz für diesen Artikel
Author: Martin Schwarzbeck
#biometrie #gesichtserkennung #protestierende #verfolgt #weltweit #werden