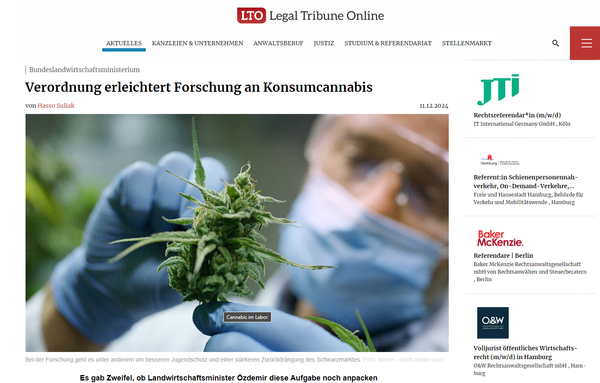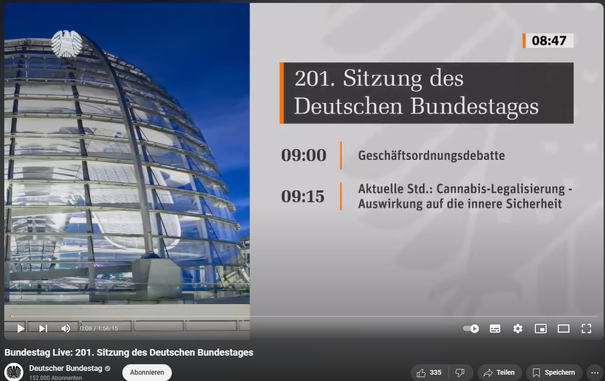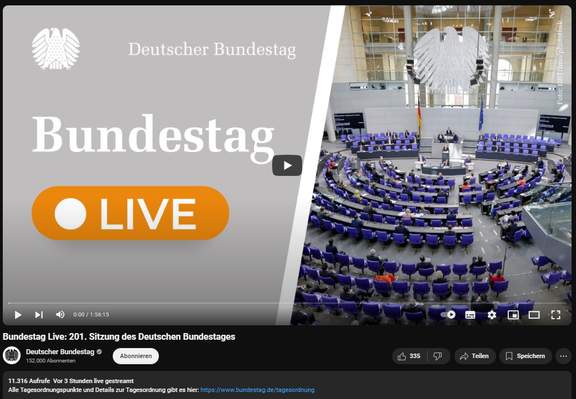https://www.fogolf.com/1043740/ball-bewegt-sich-beim-harke-entfernen-im-bunker-so-ist-die-regel/ Ball bewegt sich beim Harke-Entfernen im Bunker? So ist die Regel #BALL #BallBunkerHarke #beim #bewegt #bunker #Die #GolfRules #GolfRulesVideos #GolfRulesVlog #GolfRulesYouTube #HarkeEntfernen #ist #Regel #sich
#bewegt
🦋 Der Bett-Schmetterling – einfache Mobilisationsübung im Bett zur Lockerung von Rücken & Hüften.
Link zur Übung: https://bit.ly/4koR2sg
#Famos1Punkt0 #bewegen #bewegt #Mobilisation #Gesundheit #Rückenwohl #Bettübung #Famos1Punkt0 #ButterflyStretch #Schmerzfrei
Flattert jetzt schon das Vögelchen?
✅ Mobilisiert Schultern & Arme
✅ Löst Verspannungen
✅ Fördert Wohlbefinden & Leichtigkeit
Schau Dir die Übung dazu an: https://bit.ly/3Tmffoc
#Famos1Punkt0 #bewegen #bewegt #SchrittfürSchritt #Abheben #Lächeln
Wer die Arktis bewegt (Teil 2)
An vielen Orten der Arktis arbeiten Menschen an Lösungen für ein gutes Leben in der Region trotz steigender Temperaturen. Sie kämpfen etwa gegen den Permafrost oder bauen nachhaltig.Aktion Eiszeit
Der russische Geophysiker Sergey Zimov und sein Sohn Nikita wollen in Sibirien den Permafrost retten
Mit dem grauen Zopf und dem vor Kälte glühenden Gesicht sieht Sergey Zimov ein wenig aus, wie man sich einen russischen Mystiker an der Schwelle zum 20. Jahrhundert vorstellt. Er blickt in eine Ebene aus Nadelbäumen und Sträuchern, hebt den Kopf und stößt ein langes „hohohoho!“ aus. Die Kamera fährt zurück. Zimov sitzt auf einer runden Baracke, auf deren Dach eine riesige Satellitenschüssel steht.
Sergey Zimov, so zu sehen in einer Arte-Reportage aus dem Jahr 2017, ist Geophysiker. Sein Ziel: den Permafrost retten. Mit seinem Sohn Nikita hat er den Pleistozän-Park gegründet – zwanzig Quadratkilometer am ostsibirischen Fluss Kolyma, wo sie eine Welt erschaffen wollen, wie sie vor mehr als 10.000 Jahren hier existierte. Bis Menschen auftauchten und sich das von Mammuts und Tigern durchstreifte Weideland in eine schweigende Welt aus genügsamen Pflanzen zurückzog.
Auf Social Media zeigen aktuelle Posts Pferde und zottelige Büffel, von den Zimovs im Park angesiedelt, inmitten verschneiter Weite. Eine Interview-Anfrage beantwortet Nikita Zimov: Er ist busy, gerade weit draußen, in zwei Wochen erst zurück in der Zivilisation, dann könne man sprechen.
Was haben große Säugetiere mit dem Permafrost zu tun – gefrorenem Boden, der droht, zu Schlamm zu werden und dabei riesige Mengen Treibhausgase in die Atmosphäre auszuatmen? Denn mit seinem Auftauen erwachen im Permafrost enthaltene Mikroben aus einem jahrtausendelangen Schlaf. Sie beginnen, Pflanzenreste zu fressen, die ebenfalls auftauen. Dabei entstehen Kohlendioxid und Methan.
Der Plan von Nikita und Sergey Zimov: Rentiere, Elche, Moschusochsen sollen den Schnee im Park so dicht trampeln, dass die Kälte im Winter besser in den Boden eindringen kann. Das schützt den Permafrost. Zudem fressen die Tiere die jetzige Vegetation aus Sträuchern und Bäumen so stark ab, dass sich im Sommer wieder Grasland ausbreitet. Das helle, nährstoffreiche Grün böte den Tieren, die derzeit im Park noch zusätzlich gefüttert werden müssen, ausreichend Nahrung und reflektierte zudem die Sonne besser als die braune Tundra – der Boden bliebe kühler.
Sergey Zimov im Pleistozän-Park, Foto: IMAGO / imagebrokerDie Idee findet weltweit Beachtung: Unter anderem konnten die Zimovs ihr Projekt im Fachmagazin Nature vorstellen, Zeitungen wie National Geographic oder die New York Times berichteten. Torben Windirsch, Permafrostexperte am Alfred-Wegener-Institut in Potsdam, sagte zum Wissenschaftsmagazin
Spektrum, er halte die Theorie der Zimovs für spannend, weil die Pflanzenfresser das Tauen des sibirischen Bodens auf unterschiedliche Weise bremsen könnten.
Einen Tag vor dem Interview die finale Absage. Er werde länger bleiben, schreibt Nikita Zimov. Eine Mail mit Fragen bleibt unbeantwortet. In Studien aber berichten die Zimovs von ihren Messungen: Seit Beginn des Experiments 1996 hätten sich vermehrt Gräser im Park ausgebreitet, der Boden speichere mehr Kohlenstoff, die Bodentemperatur sei gesunken. Doch sind die Zimovs möglicherweise nicht nur unkonventionelle Visionäre – sondern auch ein wenig durchgeknallt? Immerhin würden sie eines Tages gern Mammuts im Park ansiedeln. Andererseits: Ohne ein wenig Verrücktheit wäre ein spendenfinanziertes Projekt wie der Pleistozän-Park kaum machbar. Wie sagt Sergey Zimov in der Doku? „Ich will, dass das Leben hier wieder Einzug hält.“
Bauen, wo die Gletscher schmelzen
Der dänische Architekt Kasper Pielemand konstruiert nachhaltige Gebäude in Grönland
Rund 250 Kilometer nördlich des Polarkreises schmiegt sich ein futuristisches Gebäude in die verschneite Felslandschaft. Stahl, Holz und Glas tragen das gebogene Flachdach. Das Icefjord-Center in Ilulissat, Westgrönland, ist das erste Arktis-Projekt der dänischen Architektin Dorte Mandrup. 2016 erhielt sie den Zuschlag für die Planung, eine völlig neue Aufgabe. „Wenn wir in Kopenhagen bauen, haben wir etwa 95 Prozent des Wissens, das wir brauchen. Bei der Arbeit in Grönland wussten wir gerade mal 5 Prozent“, sagt Kasper Pielemand. Er ist für die Arktis-Projekte verantwortlich.
Unsere Dacheindeckung muss Temperaturen von plus 50 bis minus 40 Grad standhalten — Kasper PielemandDie Planung des Icefjord-Centers war für ihn das erste Projekt in der Region. Über Wochen suchten Pielemand und sein Team nach dem besten Design, den richtigen Materialien. Im Sommer 2019 startete der Bau. Sechsmal reiste Pielemand zur Stippvisite nach Grönland. Immer wieder musste das Team seine Pläne an die arktischen Bedingungen anpassen. Auch die Corona-Pandemie erschwerte die Arbeit. Jeder Besuch hieß Quarantäne, die Pielemand mit Dutzenden Spaziergängen durch die Landschaft verbrachte. „Ich habe die großartige Natur erlebt, um die es bei dem Projekt geht.“ Das Icefjord-Center liegt in direkt am Sermeq-Kujalleq-Gletscher, einem der wenigen, durch den das grönländische Inlandeis ins Meer gelangt. Zu dem vielen Schmelzwasser und Schnee kommen starke Winde und extreme Temperaturen. „Unsere Dacheindeckung muss Temperaturen von plus 50 bis minus 40 Grad standhalten“, erklärt Pielemand.
Wie die Flügel einer Schneeeule: das Icefjord-Center in Ilulissat, Westgrönland, Foto: Dorte Mandrup KangiataErgebnis ist ein Gebäude, das an die Flügel einer Schneeeule erinnern soll. Durch die aerodynamische Form fegt der Schnee im Winter sowohl über als auch unter das Gebäude, damit der Eingang nicht zuschneit. Wenn es wärmer wird, fließt das Schmelzwasser unter dem Bau hindurch. Der Eingriff in die Umwelt ist minimal. „Wir haben ein festes Fundament am Ende des Gebäudes, der Rest steht auf Pfeilern.“
Erst sollte der Bau fast ausschließlich aus Holz entstehen. „Aber Temperaturen und Feuchtigkeit haben sich in den letzten 20 Jahren ziemlich dramatisch verändert. Stahl ist besser geeignet und weniger wartungsaufwendig“, sagt Pielemand. 80 Prozent des Stahls sind recycelt und wiederverwertbar. Allerdings gibt es keine lokale Produktion von Stahl, Holz und Glas, weder in Grönland noch anderswo innerhalb des Polarkreises. Für das Icefjord-Center musste alles über Dänemark importiert werden. Das ist teuer und, natürlich, nicht wirklich nachhaltig.
Nachhaltig bauen in der Arktis, geht das überhaupt? „Bauen trägt immer zum Klimawandel bei, egal wie.“ Aber auch soziale Nachhaltigkeit spiele bei Bauprojekten in der Region eine wichtige Rolle. Weil durch den Klimawandel die Jagd als Lebensgrundlage für die lokale Bevölkerung immer schwieriger werde, könnten Bauprojekte behutsam den Tourismus fördern und so die Gesellschaft vor Ort erhalten. Das Icefjord-Center erklärt Besucher:innen zudem in der Ausstellung, wie der Klimawandel die Eisdecke in Grönland immer weiter zerstört – damit sie verstehen, warum es so wichtig ist, sie zu schützen.
Nicht mal zwei Jahre nach Baubeginn eröffnete das Icefjord-Center. Weil es im Sommer kaum dunkel wird, konnte teilweise rund um die Uhr gebaut werden. Zwei weitere Arktis-Projekte der Firma in Norwegen und eines in Kanada sind gestartet. Bauen in der Arktis hat Zukunft, glaubt Pielemand. „Es wird eine wachsende Nachfrage geben und hoffentlich auch den Wunsch, dabei möglichst nachhaltig vorzugehen.“
Wer die Arktis bewegt (Teil 1)
An vielen Orten der Arktis arbeiten Menschen an Lösungen für ein gutes Leben in der Region trotz steigender Temperaturen. Sie ermutigen zum Beispiel junge Menschen in der Region zum Engagement oder organisieren Jugendkonferenzen.Respektiert die Natur
Olga Ievleva, 25, ist Komi und engagiert sich im Arctic Youth Network
„Ich liebe die arktische Region und die vielen unterschiedlichen Menschen, die dort leben. Es gibt viele indigene Gruppen und alle haben eines gemeinsam: tiefen Respekt vor der Natur. Nach meinem Master 2023 habe ich mich beim Arctic Youth Network, einer Non-Profit-Organisation junger Menschen der Region, für den Vorstand beworben. Im Dezember ging es los, ehrenamtlich. Seit Mai 2024 bin ich Vorsitzende.
Ich möchte jungen Leuten zeigen: Egal wie klein und abgelegen ihr Heimatort in der Arktis auch ist – es gibt Möglichkeiten, etwas zu bewegen. Bei unserem letzten Meeting haben wir diskutiert, wie künftige Umweltjurist:innen diverse Perspektiven in ihrer Ausbildung ansprechen und auch institutionelle Veränderungen anstoßen können. Damit zum Beispiel der Schutz indigener Rechte oder Territorien häufiger Thema im Studium wird. Durch die Zusammenarbeit mit einem Alumni-Netzwerk haben wir Kontakte zu Universitäten und können Neuerungen anstoßen.
Ich bin mit Kühen, Hühnern und Gänsen aufgewachsen, habe mit meinem Vater Fische im Fluss hinter unserem Haus gefangen. Wir konnten uns gut selbst versorgen — Olga IevlevaIch bin in dem Örtchen Noshul’ im Süden der russischen Republik Komi aufgewachsen. Wir gehören zum finno-ugrischen Kulturkreis und sind mit Menschen aus Finnland, Ungarn und Estland verwandt. Meine Großeltern sprachen mit mir auf Komi, anders als meine Eltern. Als Teil der Russischen Förderation war es ihnen wichtig, dass ich akzentfreies Russisch beherrsche. Ich bin mit Kühen, Hühnern und Gänsen aufgewachsen, habe mit meinem Vater Fische im Fluss hinter unserem Haus gefangen. Wir konnten uns gut selbst versorgen.
Zur achten Klasse bin ich in die Hauptstadt der Republik Komi gezogen, nach Syktyvkar, 200 Kilometer von zu Hause entfernt – ohne meine Eltern. Das war schon schwierig, aber für meine Identitätssuche sehr wichtig. Dort habe ich viel über die Komi-Kultur gelernt, da das Teil des Lehrplans war. Wir sprachen über ihre Mythologie, lernten Weben, wie es bei den Komi traditionell üblich ist. In der Schule habe ich erst so richtig realisiert, dass ich nicht nur russische Staatsbürgerin bin, sondern auch Vertreterin einer indigenen Gruppe.
Im letzten Schuljahr habe ich mir ein Drohnen-Video von der Arktis angeschaut, durch die ein Eisbrecher fuhr – ich war schockverliebt. Ich wusste, da möchte ich hin und das Eis mit eigenen Augen sehen. Auch deshalb habe ich mich in meinem Master International Relations für den Schwerpunkt Arktis entschieden.
In meiner Doktorarbeit beschäftige ich mich jetzt mit den Jagd-Regularien der kanadischen Regierung, die sie den Inuit in Nunavut auferlegen. Die Inuit finden die Jagdquote unverhältnismäßig niedrig, und ich möchte das untersuchen. Es ist wichtig die Ernährungssicherheit der Menschen dort zu verbessern. Weil vieles importiert werden muss, sind Lebensmittel dort sehr teuer. Die kanadische Regierung will die Tiere schützen, die Inuit kämpfen mit Nahrungsknappheit – ich würde gerne vermitteln und mich für einen ausgewogenen Schutz der indigenen Rechte starkmachen.“
Plötzlich im Mittelpunkt
Embla Elde, 23, organisiert Jugendkonferenzen in der Arktis
Es ist einer dieser Tage, an denen die Arktis nicht auf freundlich tut. Januar 2022. Vor den Bürofenstern ist es finster, dichte Wolken hängen über Tromsø, die Lichter am Hafen schimmern im Fjord. Doch Embla Elde friert nicht – erst vor ein paar Stunden ist sie in Oslo in den Flieger gestiegen, Schneesturm, Verspätung, in Tromsø direkt ins Taxi, weiter zum Treffen mit der norwegischen Ex-Diplomatin und Unternehmerin Goril Johansen – nun steht sie noch in Daunenjacke eingepackt, Koffer in der Hand, vor einem langen Tisch mit zwanzig Mitarbeiter:innen von Universitäten, lokalen Geschäftsleuten, Politiker:innen. „Was können wir für dich tun?“, fragen sie. „Mein Herz rutschte in die Hose“, erzählt Elde. „Plötzlich stand ich im Mittelpunkt – bei der Vorbereitung der Arktis-Jugendkonferenz.“
Elde wächst in Hokksund auf, einer kleinen Stadt im Südosten Norwegens. „Da gibt es praktisch nichts, außer Landwirtschaft und Industrie. Die jungen Leute ziehen alle weg“, sagt Elde, ihre blonden Haare kräuseln sich über ihre gelbe Bluse. Gerade lebt sie in Berlin. „Ich war sehr ehrgeizig als Kind, mit vier wollte ich Gehirnchirurgin werden, mit zwölf Diplomatin.“ Klar ist: irgendwas, wo man etwas verändern kann. Elde macht ihren Bachelor in Internationalen Beziehungen an der Universität Oslo, danach den Master in International Affairs an der Hertie School in Berlin. Schon während der Schule engagiert sie sich beim European Youth Parliament (EYP), einem Netzwerk, in dem junge Menschen über Politik diskutieren. Dort trifft sie Henning Undheim, die beiden werden Freunde – und haben eine Idee: Warum nicht ein Projekt für junge Menschen zur Arktis starten? „Viele haben so gut wie keine Berührungspunkte mit der Region, das wollten wir ändern“, sagt Elde. Dafür brauchen sie Geld. Elde und Undheim schreiben Stiftungen an, die Gemeinde in Tromsø, das norwegische Außenministerium. „Am Anfang nahm man uns oft nicht ernst.“ Zu Meetings nimmt sie eine einseitige Projektbeschreibung für Investor:innen mit.
Wir wollten keine Schein-Inklusion Indigener. Wir haben die Bühne gestellt – über den Inhalt entschieden sie — Embla EldeMärz 2023. 350 junge Menschen aus 32 Ländern kommen in Tromsø zusammen, von Armenien bis Aserbaidschan. „Wir haben einen ganzen Campingplatz gemietet“, sagt Elde. Die Teilnehmer:innen schlafen in Hütten, nachts flackern über ihren Köpfen die Nordlichter. Abends gibt es eine Sámi Culture Night, Talentshows, Konzerte. „Wir wollten keine Schein-Inklusion Indigener. Wir haben die Bühne gestellt – über den Inhalt entschieden sie“, so Elde. Was jungen Indigenen wichtig ist? Dass die Arktis ein bewohnbarer Ort bleibt. Sie endlich gehört werden. „Ohne die Leute vor Ort in Tromsø hätten wir das nie geschafft. Ein norwegischer Fischerverband spendierte uns 70 Kilogramm Kabeljau.“
Die Veranstaltung schlägt Wellen: Wenig später organisiert WWF Schweden das Projekt Youth Together 4 Arctic Futures – und fragt Elde und Undheim, ob sie im Jugendausschuss und beim Planen der jährlichen Arktiskonferenz aushelfen möchten. „Unser Ansatz gefiel ihnen“, sagt Elde.
Doch was bringt sowas – außer Symbolkraft? „Klar lässt ein Trump sich nicht von ein paar jungen Menschen sagen: Keine Invasion Grönlands. Doch wer eine starke Jugendarbeit hat, indigene Völker einbezieht und konstruktiv den Klimawandel zum Thema macht, schafft eine gute Grundlage für Gespräche – auch auf hoher Ebene.“
@DerKlimablog 👍 😍 😎 👯 🙏 nicht nur #Hanfgeschichten werden #bewegt geschrieben. #Zeitgeschichte #Zeitgeschehen #Bewegung #Movement
#Kulturkampf #Resilienz #MajaGöpel #ClaudiaKemfert #DerKlimablog #Merz #Klima #futureisnow #actnow #forfuture #Zukunft #rp25 #republica #GoldenPath gibt es sowas?
#Arme über #Kreuz heben, so lautet die 10.Episode der #Turnübungen mit den Puppen
Hier geht's zur Übung: https://bit.ly/4kwBeEs
#Famos1Punkt0 #bewegen #bewegt #Dehnung #FitnessImBett #Morgenroutine #Stretching #RückenFit #SchrittfürSchritt #Lächeln
Die 9.Episode der #Turnübungen mit den Puppen hat den Titel #Hände hinter den #Kopf.
Hier geht's zur Übung: https://bit.ly/3Sugpxk . Viel Spass
#Famos1Punkt0 #bewegen #bewegt #Stressabbau #Entspannung #StrechAndSmile #WakeUpStretch
#Zeitgeschichte wird #bewegt geschrieben. 👯
https://troet.cafe/tags/Zeitgeschichte
#Angst #fear #Angstlos #fearless #Trauma #Traumata #noTrauma #noPain
https://troet.cafe/tags/EndocannabinoidSystem #Cannabis #Hanf
#WokeineAngstmehristdawerdenurnochICHsein #DasSeinbestimmtdasBewusstsein
#YOUAREtheUNIVERSE 🙏 https://troet.cafe/tags/wepray 🙏
🙏 #Coldplay #Universe #Universum https://youtu.be/WTC6iJYBAVI 🙏 #wepray
#Ozzy #dream #dreamer #dreaming #Infinity #mother #earth #motherearth #Erde #Hanfgeschichten
😎 https://youtu.be/LCCiwPEdEpg 😎
Was verbirgt sich hinter der 8.Episode der #Turnübungen mit den Puppen und dem Titel #Schulter_hochziehen?
Schaut Euch die Übung an: https://famos1punkt0.de/blog/08-schulter-hochziehen-stressabbau-im-bett/
#Famos1Punkt0 #bewegen #bewegt #SchrittfürSchritt #loslassen #Hingabe #Stressabbau #Entspannung
Mit einem besonderen Bild bei der Produktion von 05 Kopf Rechts-Links; Nackenübung im Bett: https://famos1punkt0.de/blog/05-kopf-rechts-links-nackenuebung-im-bett/
#Famos1Punkt0, #bewegen, #bewegt, #SanftEntspannen, #Lockerung, #Loslassen
#Tagebuch 12.02.2025 #CRISPR_rEvolution #THErealLIFE
https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-vom-11-februar-2025-100.html
#Zeitgeschichte wird #bewegt geschrieben. 👯
https://troet.cafe/tags/Zeitgeschichte
#Angst #fear #Angstlos #fearless #Trauma #Traumata #noTrauma #noPain
https://troet.cafe/tags/EndocannabinoidSystem #Cannabis #Hanf
#WokeineAngstmehristdawerdenurnochICHsein #DasSeinbestimmtdasBewusstsein
#fRIDAYSFORFuture #Rassismus = #Hanfverbot = #Brutalisierung #Gesellschaft = #NAZI:Plan? #Parallelen #Klimaschutz? #OmasforFuture #Politik #politics #Hanfgeschichten
@creativesforfuture @luisaneubauer #Luisa #wepray 🙏 😎 😀
#Demokratie
#Brandmauer
#LuisaNeubauer 👍 👍 📡
#eyecontact
#Hanfgeschichten #Frauengeschichten #Zeitgeschichte wird #bewegt geschrieben #FridaysforFUTURE
#SPD #FDP #noAfD #CSU #CDU #Christen #Kirche #love #onelove #klimaschutz ist #kinderschutz #USA #Germany #kunst #kultur #kulturgeschichten #Hoffnungsgeschichten #forfuture #Liebesgeschichten #DUBISTdasUNIVERSUM #savePlanetA #AbwesenheitvonLicht #Licht #schwarzblau ist [k]eine Farbe?
#Zeitgeschichte wird #bewegt geschrieben. 👯
https://troet.cafe/tags/Zeitgeschichte
#Angst #fear #Angstlos #fearless #Trauma #Traumata #noTrauma #noPain
https://troet.cafe/tags/EndocannabinoidSystem #Cannabis #Hanf
#WokeineAngstmehristdawerdenurnochICHsein #DasSeinbestimmtdasBewusstsein
💔 #IwillFOLLOWYOU 🙏 https://youtu.be/AyZAJQgrXKk 🙏 🎵
🙏 #Coldplay #Universe #Universum https://youtu.be/WTC6iJYBAVI 🙏 #wepray
#Ozzy #dream #dreamer #dreaming #Infinity #mother #earth #motherearth #Erde
😎 https://youtu.be/LCCiwPEdEpg 😎
{Philipp
Der Bericht hat mich richtig #bewegt und mir #Hoffnung gemacht
@philipp
#klimakrise #Aktivismus #demonstration #fridaysforfuture #arteTRACKS } 👍 #CRISPR_rEvolution #hope
https://youtu.be/4CFzGzWS708 🙏 #wepray for 👯👯👯
#Hanfgeschichten #Zukunft #Zeitgeschichte #future
#SPD #FDP #noAfD #CSU #CDU #Christen #Kirche #love #onelove #klimaschutz ist #kinderschutz
#USA #Germany #kunst #kultur #kulturgeschichten #Hoffnungsgeschichten #CANnabiS #Liebesgeschichten #DUBISTdasUNIVERSUM #savePlanetA
{Philipp
Der Bericht hat mich richtig #bewegt und mir #Hoffnung gemacht
@philipp
#klimakrise #Aktivismus #demonstration #fridaysforfuture #arteTRACKS } 👍 #CRISPR_rEvolution #hope
https://youtu.be/4CFzGzWS708 🙏 #wepray for 👯👯👯
#Hanfgeschichten #Zukunft #Zeitgeschichte #future
#SPD #FDP #noAfD #CSU #CDU #Christen #Kirche #love #onelove #klimaschutz ist #kinderschutz #USA #Germany #kunst #kultur #kulturgeschichten #Hoffnungsgeschichten #CANnabiS #Liebesgeschichten #DUBISTdasUNIVERSUM #savePlanetA
{Das #Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) teilte mit, dass die erlassene #KonsumcannabisWissenschaftsZuständigkeitsverordnung der BLE ermöglicht, im Zusammenhang mit #Cannabis stehende #Forschungsanträge zu prüfen und die genehmigten #Projekte zu überwachen.}
Immerhin #bewegt sich was 😎 #wepray ein #Quantensprüngchen 😃 #Hanfgeschichten #Hanf #hemp #science #Endocannabinoide
#Bewegung #Bewegtheit #Germany #USA #Italy #politics #Wahrhaftigkeit #Gerechtigkeit #climatecrisis
⬆️ ⬆️ ⬆️ ⬆️
Die #CannabisDebatte in einer Videoaufzeichnung
#NieWiederKriminell #niewiederCDUCSU
#fridaysforfuture
#Hanfgeschichten
#COP29
#kultur
https://troet.cafe/tags/hanfliebe 👯 💔
#Hanfwissen
#hanfliebe
#kulturgeschichten
#klimaschutz
#USA
#Germany
#KamalaHarris
#GeschichtenErzählen
#WEEDMoB #Cannabis #Bundestag
#Zeitgeschichte wird #bewegt geschrieben! 😎 😀 #wepray 🙏
#Zeitgeschichte wird #bewegt geschrieben!
https://troet.cafe/tags/FranjoGrotenhermen
https://troet.cafe/tags/Methylierung
#Cannabis #Hanf #hemp #Politik #politics #kunst #kultur #Hanfgeschichten #Bayern #WEEDMoB #Deutschland and #USA
#EPIGeNETICS #EPIGeNETIK #Neuroprotection
https://troet.cafe/tags/FincenFiles
#Zusammenhänge - #1000Puzzleteile 👯https://troet.cafe/tags/Prohibition [alle links durcharbeiten bitte] 😎
#Zeitgeschichte wird #bewegt geschrieben. 👯
https://troet.cafe/tags/Zeitgeschichte
#Angst #fear #Angstlos #fearless #Trauma #Traumata #noTrauma #noPain
https://troet.cafe/tags/EndocannabinoidSystem #Cannabis #Hanf
#WokeineAngstmehristdawerdenurnochICHsein #DasSeinbestimmtdasBewusstsein
#KamalaHarris 🙏 https://troet.cafe/tags/wepray 🙏
🙏 #Coldplay #Universe #Universum https://youtu.be/WTC6iJYBAVI 🙏 #wepray
#Ozzy #dream #dreamer #dreaming #Infinity #mother #earth #motherearth #Erde
😎 https://youtu.be/LCCiwPEdEpg 😎



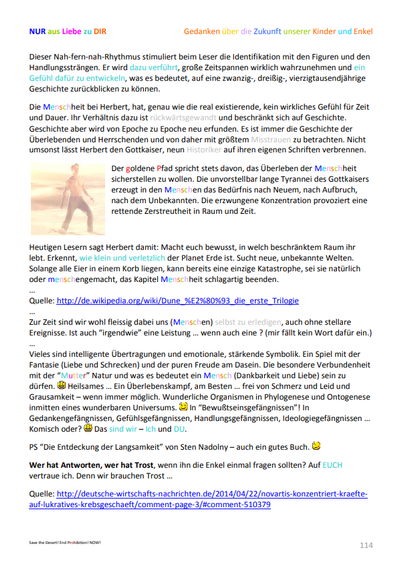


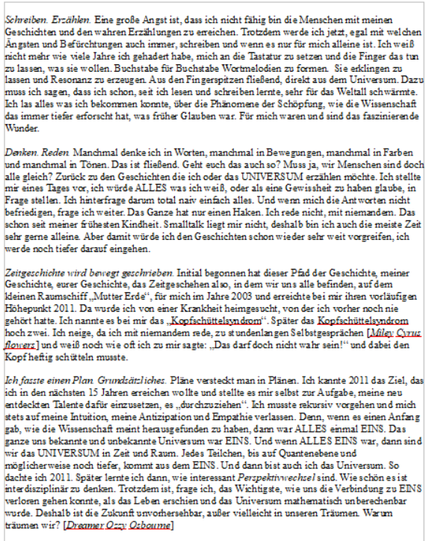
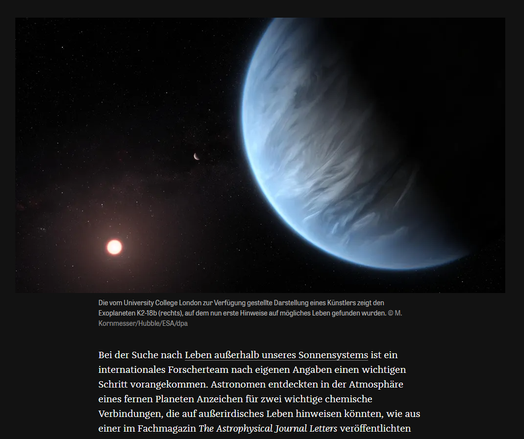


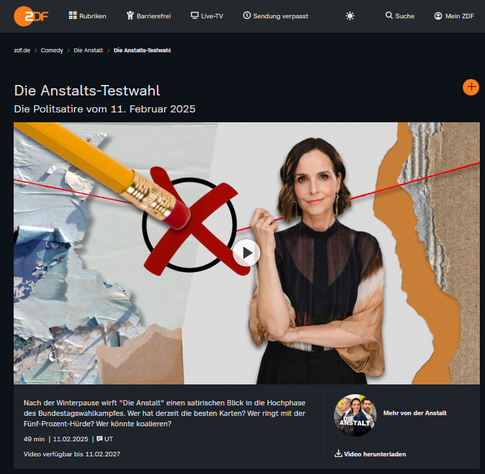

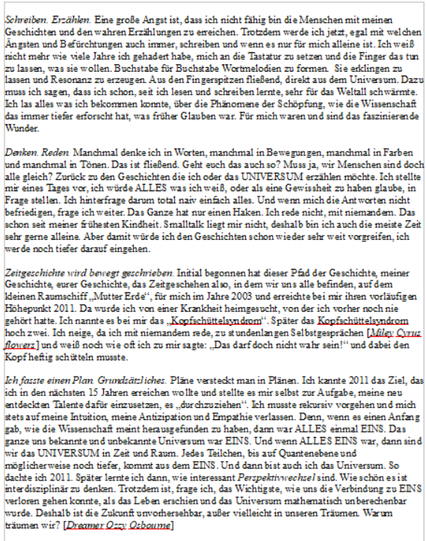

![Screenshot 03 Januar 2025 - Planet: Erde Status für die Menschheit? schwer zu sagen [perspektivisch]
Ausschnitt aus dem Video, das demonstrierende Menschen zeigt, die mit ihrer Kunst ihre Liebe für unsere und kommende Generation ausdrücken - zu lieben heißt auch Verantwortung zu haben, für diese Geschenke des Universums! Fürsorgliche Zärtlichkeit und Aufrichtigkeit, Dazugehörigkeit, Geborgenheit, Vertrauen, Zusammenhalt, ... ;-)
4.463 Aufrufe 28.11.2024 #demo #party #aktivismus
"Wir bringen die Demo in die Party und die Party in die Demo." Bei Klima-Protesten für Stimmung sorgen: das ist das Ziel der "Artivisten", Aktivisten, die ihre Kunst in den Dienst unseres Planeten stellen. Sie konzipieren ihre Auftritte so, dass sie sich in soziale Bewegungen einfügen, und kämpfen mit Kontrabassbogen, Plattenspielern oder Choreografien, die ihrem Zorn Ausdruck verleihen. Wenn Kreativität Demonstrationen neu erfindet, werden diese visueller, fröhlicher, überzeugender – und sie gehen viraler.](https://files.mastodon.social/media_attachments/files/113/763/770/928/990/749/small/be04d9915aed2deb.png)